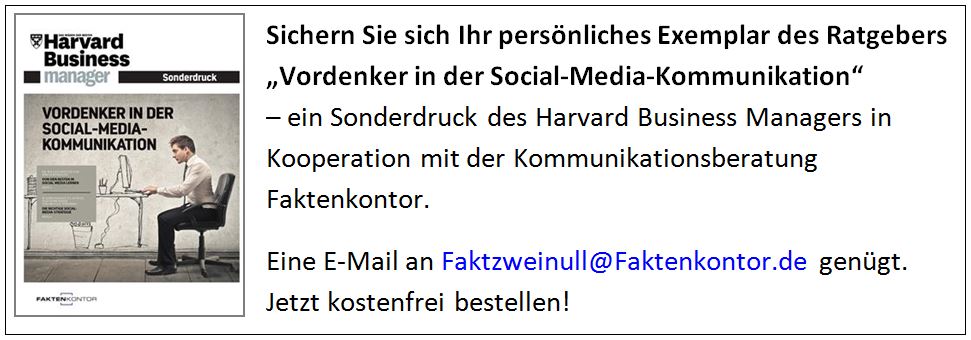Vorwurf: Presse bei Polizeirazzia gegen Putsch-Prinz als „PR-Aktion“
Mit einer Großrazzia an mehr als einem Dutzend Orten platzt in den frühen Morgenstunden des 7. Dezembers ein reichsbürgerischer Fiebertraum vor laufenden Kameras: Ein geriatrischer Prinz aus einem kleinen Adelshaus wollte sich mithilfe ehemaliger Soldaten und Polizisten gewaltsam zum König von Deutschland hochputschen. Insgesamt 25 als Möchtegern-Revoluzzer Verdächtige werden verhaftet – begleitet von einer Heerschar von Journalisten. Die waren lange vorher informiert, inklusive Namen der Zielpersonen, Einsatzorten und -zeit.
Das brachte den Ermittlungsbehörden Vorwürfe ein: Sie hätten ein Durchsickern des Einsatzes an die Verdächtigen riskiert und damit nicht nur die Beseitigung von Beweismitteln ermöglicht, sondern auch das Leben der beteiligten Beamten gefährdet. Mutmaßlich mit dem Ziel, die Razzia so bildstark als „PR-Aktion“ zu nutzen. Dabei die Gefahr durch die Putschisten hochzuspielen, in dem sie „mit Kanonen auf Spatzen“ schießen. Mit den Vorab-Informationen hätten die Behörden die Medien zum Teil der Inszenierung ihres Fahndungserfolgs gemacht – und das berge die Gefahr einer zu großen Nähe und Abhängigkeit „als eine Art des gegenseitigen Gebens und Nehmens“.
War die Vorab-Information von Journalisten durch staatliche Stellen also ein Fehler, oder gar ein Skandal?
Um es norddeutsch zu sagen: Nö.
Selbstredend: Bloß, um Schlagzeilen zu machen, unnötig vertrauliche Informationen zu veröffentlichen, die nicht nur den Erfolg von polizeilichen Maßnahmen, sondern auch die Sicherheit von Einsatzkräften gefährden, ist keine gute Idee.
Aber die Schlüsselwörter hier sind „unnötig“ und „veröffentlichen“.
Auch wenn der wahnwitzige Putsch-Plan und seine Vereitelung für die breite Öffentlichkeit überraschend kam – er fand nicht plötzlich im luftleeren Raum statt. Viele der Verhafteten, inklusive des von der Familie Reuß verstoßenen dreizehnten Prinzen Heinrichs, stehen schon seit langem nicht nur im Visier der Fahndungsbehörden, sondern auch von investigativen Journalisten (unter anderem von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung). Im Unwissen über die Ermittlungen und die geplante Razzia gelassen, hätten sie die Umstürzler durch eigene Recherchen und Berichte aufschrecken können. Die Redakteure ins Vertrauen zu ziehen diente also gerade dazu, den Fahndungserfolg zu sichern – dies zu unterlassen, hätte ihn gefährdet. Die Vorab-Information war also keineswegs unnötig, sondern im Sinne der Polizeiarbeit zweckmäßig und zielführend.
Obgleich die genauen Informationswege nicht bekannt sind, kommt das Teilen der vertraulichen Informationen auch nicht einer Veröffentlichung gleich – es wurde schließlich keine Presseinformation breit gestreut, sondern offensichtlich gezielt konkrete, bekannte Reporter angesprochen.
Auch das „gegenseitige Geben und Nehmen“ sehe ich in diesem Zusammenhang nicht als Problem oder Anzeichen von Klüngelei, sondern als geradezu notwendigen Teil der Arbeit beider Seiten – Medien und Staatsgewalt. Wenn Polizei oder Staatsanwaltschaft möchten, dass die Medien ihre Berichterstattung zu einem Fall aus ermittlungstaktischen Gründen für eine Zeit aussetzen, müssen sich die Redaktionen im Gegenzug darauf verlassen können, dass diese Bitte nicht grundlos oder gar aus niederen Beweggründen (z.B. Vertuschung eigener Fehler) ausgesprochen wird. Und dass diese Stillhaltephase nicht länger eingefordert wird, als unbedingt notwendig. Solche Stillhalte-Abkommen zwischen Behörden und Presse können nur funktionieren, wenn zwischen beiden Seiten begründetes Vertrauen besteht. Und das wird, wie regelmäßige Reputationzweinull-Leser wissen, durch das Beweisen von Kompetenz, Integrität und Benevolenz gewonnen. Sprich: Wenn Polizei und Staatsanwaltschaft auch in Zukunft möchten, dass sich die Medien zur Gefahrenabwehr zu einem bestimmten Thema von öffentlichem Interesse eine Zeit lang bedeckt halten, müssen sie den Journalisten anschließend auch zeigen, dass sie solche Maulkörbe weder unbegründet verteilen noch diejenigen abstrafen, die sich daran halten. D.h., sobald der Grund zur Geheimhaltung wegfällt, müssen sie den Journalisten die Berichterstattung ohne Zeitverzug umgehend wieder freigeben. Und den Nachweis erbringen, dass sie bis dahin im jeweiligen Einzelfall wirklich notwendig war. Umgekehrt müssen sich die informierten Journalisten auch des in sie gesetzten Vertrauens würdig erweisen, in dem sie die vertraulich erhaltenen Informationen erst nach der Sperrfrist weitergeben.
In dieser Hinsicht erinnert mich der aktuelle Fall an die Entführung des Hamburger Mäzens Jan Philipp Reemtsma im Jahr 1996. Die Polizei forderte Journalisten damals innständig auf, kein Wort über den Fall zu berichten, bevor der Entführte wieder in Freiheit war. „Noch nie haben so viele Redaktionen wochenlang von einem derartigen Fall gewußt und doch allesamt dichtgehalten“ (Spiegel 18/1996). Noch vor weniger als zwei Jahren hielt Die Welt eine derart erfolgreiche Nachrichtensperre im Angesicht hunderter eingeweihter Journalisten für „heute unvorstellbar“.
Doch im Falle des Putsch-Prinzen scheint das Unvorstellbare einmal mehr vorbildlich funktioniert zu haben.
Bleibt der Vorwurf der Razzia als „PR-Aktion“ für die Ermittlungsbehörden. Aber wenn, wie es mir hier scheint, die Vorab-Information an ausgewählte, vertrauenswürdige Journalisten den Fahndungserfolg und die Polizeikräfte nicht gefährdet, sondern unterstützt, sehe ich auch die Öffentlichkeitswirksamkeit des Einsatzes keineswegs als verwerflich. Denn die dient weniger dazu, die Behörden in ein – gar unverdientes – gutes Licht zu rücken. Sondern vor allem dazu, Nachahmer abzuschrecken. Und damit ist uns allen geholfen.
Roland Heintze
www.reputationzweinull.de
Schauen Sie für Neustes zum Thema Krisen-PR auch bei Mediengau vorbei!
Quelle Beitragsbild: @prochurchmedia | https://unsplash.com/de/fotos/3E3AVpvlpao